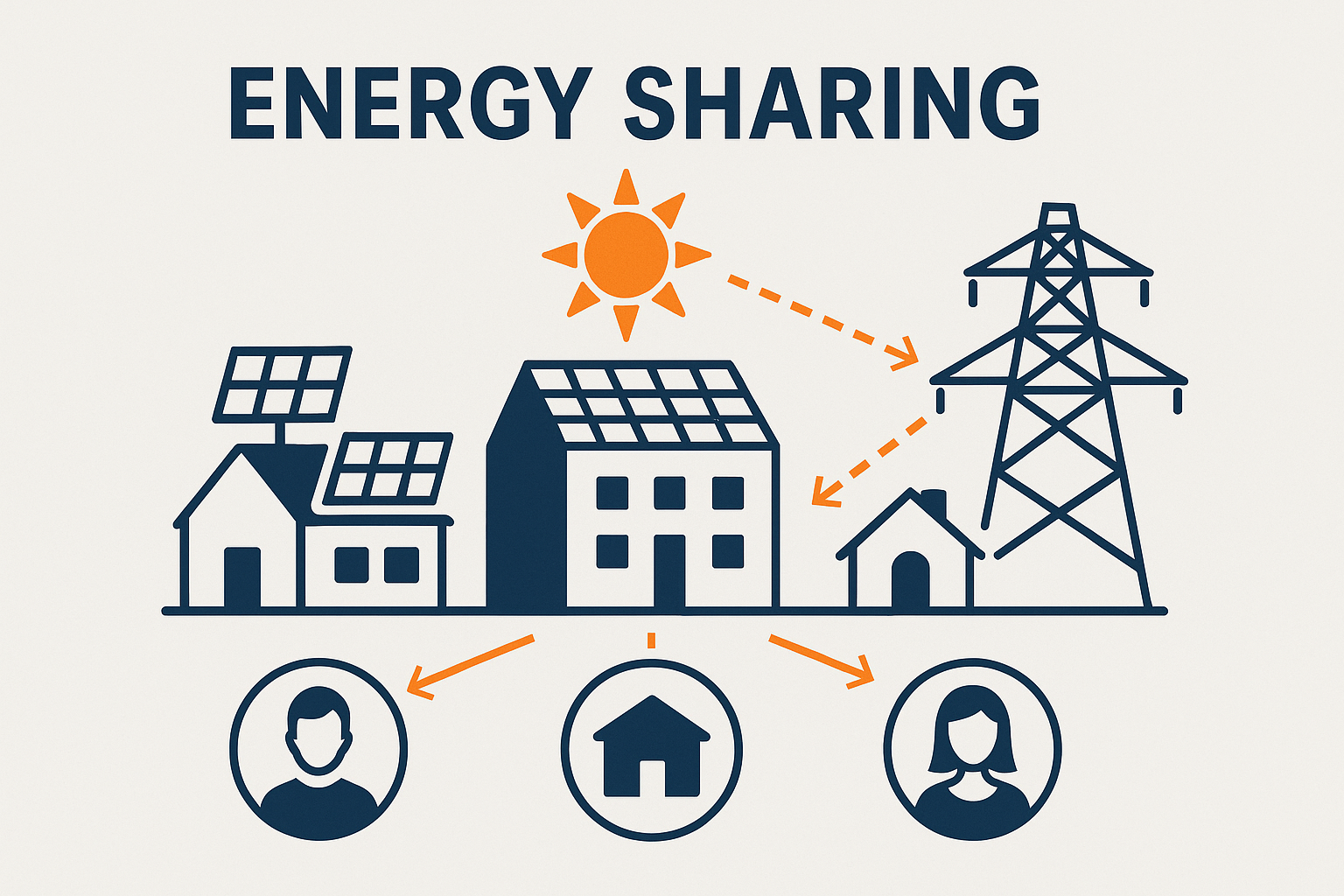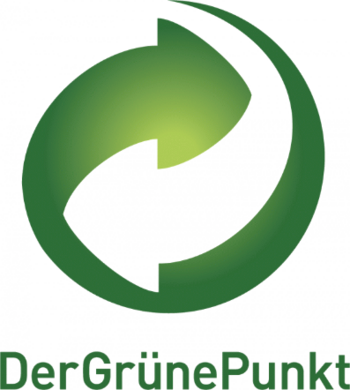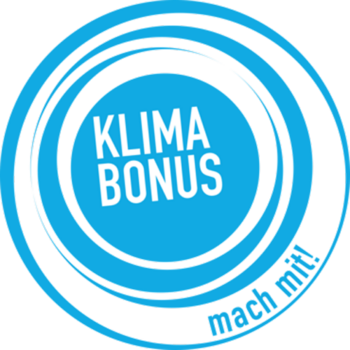EnergySharing: Gemeinsam Strom nutzen – Modelle, Chancen und der aktuelle Rechtsrahmen (2025)
Kurz gesagt
- EnergySharing = gemeinschaftliche Nutzung erneuerbaren Stroms – auch über das öffentliche Netz.
- In Deutschland gibt es bisher Mieterstrom (§ 42a EnWG) und Gemeinschaftliche Gebäudeversorgung (§ 42b EnWG).
- Netzbasiertes EnergySharing (§ 42c EnWG) ist geplant, der Gesetzentwurf liegt seit September 2025 im Bundestag.
- EU-Recht gibt das schon vor (RED III, Art. 15a).
👉 Mehr über Mieterstrom erfahren
👉 Zur gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung
Was ist EnergySharing?
EnergySharing beschreibt die gemeinsame Nutzung von Strom aus erneuerbaren Energien durch mehrere Verbraucher. Das Besondere: Der Strom kann nicht nur gebäudeintern, sondern künftig auch netzgestützt zwischen verschiedenen Liegenschaften geteilt werden.
Die EU-Richtlinie RED III (2024/1711) hat EnergySharing als Recht verankert. Deutschland setzt das aktuell über neue Vorschriften im EnWG (§ 42c) um.
Die drei Modelle im Überblick
1. Mieterstrom (§ 42a EnWG)
- Solarstrom wird im Gebäude erzeugt und direkt an Mieter geliefert.
- Förderung: EEG-Mieterstromzuschlag (unter Voraussetzungen).
- Pflichten: Vollständige Lieferantenrolle inkl. Abrechnung und Steuern.
👉 Mehr zu Mieterstrom bei SMP Solar
2. Gemeinschaftliche Gebäudeversorgung (§ 42b EnWG)
- Ebenfalls gebäudeintern, aber bürokratieärmer als Mieterstrom.
- Kein Mieterstromzuschlag, da eigenständiges Modell.
- Ideal für WEGs und Mehrfamilienhäuser, die Strom im Gebäude teilen möchten.
👉 Zur gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung
3. EnergySharing über das Netz (§ 42c EnWG – geplant)
- Erzeugung und Verbrauch können an verschiedenen Standorten erfolgen.
- Der Netzbetreiber weist per Smart Meter die Energiemengen virtuell zu.
- Status (09/2025): Gesetzentwurf liegt im Bundestag.
Vorteile von EnergySharing
- Höherer Eigenverbrauch von PV- und Windstrom.
- Kostensenkung durch gemeinschaftliche Nutzung.
- Bessere Akzeptanz von Erneuerbaren durch direkte Teilhabe.
- Entlastung der Netze, wenn lokal erzeugt und verbraucht wird.
Herausforderungen
- Abrechnung & IT: Monatliche Mess- und Abrechnungsdaten notwendig.
- Regelungen zu Netzentgelten: Offene Frage, ob EnergySharing Vorteile bringt.
- Geografische Begrenzung: Anfänglich nur lokal bzw. netzgebietsbezogen.
- Rechtsrahmen: § 42c EnWG noch im Verfahren – endgültige Details fehlen.
Praxis-Checkliste für Eigentümer & Unternehmen
- Ziele klären: Wer soll teilnehmen? (WEG, Kommune, Gewerbepark)
- Lastprofile prüfen: Strombedarf & PV-Erzeugung abgleichen.
- Messkonzept aufsetzen: Smart Meter, Abrechnungskonzept.
- Rechtslage beachten: Heute § 42a/§ 42b, künftig § 42c.
- Pilot starten: Klein anfangen, später skalieren.